Inhalt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Der Herausgeber - Vorwort | Premessa V |
| Francesco Marchioro Psicoterapia, tra cura e senso della vita Zusammenfassung |
5 |
| James Hillman -Tradition and innovation (or Revolution) | 15 |
| Horst Kächele Regeln und Autonomie in der psychoanalytische Therapie |
35 |
| Marisa Fiumanò Etica della direzione della cura |
47 |
| Giovanni Liotti Psicoterapia e disorganizzazione dell'attaccamento |
61 |
| Oliver Seemann Der Cyber-Patient. Von der Virtualität zur Realität |
87 |
| Fausto Petrella Psicoanalisi e psicoterapia in psichiatria |
99 |
| Johann Schülein Moderne Gesellschaft und Psychotherapie |
113 |
| Leonardo Ancona Mondo interno e multi-personale. La quadratura del cerchio |
133 |
| Silvia Vegetti Finzi "Maestro e traditore", J. Hillman |
151 |
| Francesco Marchioro Interview with Anton Walter Freud Colloquio con James Hillman |
165 173 |
| Verfasser | 183 |
REGELN UND AUTONOMIE
in der psychoanalytischen Therapie
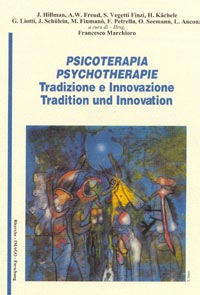 In
den technischen Empfehlungen zur "Einleitung der Behandlung"
verglich Freud die psychoanalytischen Behandlungsregeln mit den Regeln
im Schachspiel:
In
den technischen Empfehlungen zur "Einleitung der Behandlung"
verglich Freud die psychoanalytischen Behandlungsregeln mit den Regeln
im Schachspiel:
<<Zu ihrer Entschuldigung diene, daß es eben Spielregeln sind, die ihre Bedeutung aus dem Zusammenhänge des Spielplanes schöpfen müssen. Ich tue aber gut daran, diese Regeln als "Ratschläge" auszugeben und keine unbedingte Verbindlichkeit für sie zu beanspruchen.>> (Freud 1913 c, S. 454 f. )
Hier wie dort erzeugen die Regeln eine unendliche Vielfalt von Situationen,
die nur in der Eröffnungs- und Beendigungsphase eingeschränkt
sind. Die komplexen interaktionellen Sequenzen, die einer bestimmten
Form der Verteidigung oder dem Endspiel im Schach zugrunde liegen, haben
Ähnlichkeit mit den Strategien der Behandlungsführung. Für
sie lassen sich Ratschläge formulieren, die strategische Überlegungen
in Regelform fassen. Anders dagegen sind die eigentlichen Spielregeln
im Schach zu verstehen, die z. B. die Bewegungen der Spielfiguren festlegen
und gleichsam Gesetzesfunktion haben, da ihre Einhaltung erst das Schachspiel
konstituiert.
Während es im Schachspiel einfach ist, zwischen regelwidrigem und
unzweckmäßigem Vorgehen zu unterscheiden, ist dies in der
Psychoanalyse schwierig. Das liegt zum einen an der historischen Entwicklung
der psychoanalytischen Theorie und Technik, zum anderen an den unterschiedlichen
Funktionen, die psychoanalytischen Regeln eigen sind. So sei daran erinnert,
wie stark die psychoanalytische Situation bei Freud den Charakter eines
Assoziationsexperiments hatte, das zur Erforschung der Neurosenentstehung
diente. Die striktesten und eindeutigsten Handlungsanweisungen formulierte
Freud hinsichtlich der Rahmenbedingungen für diese Situation; die
Regeln sollten eine " soziale Nullsituation" (Swaan 1978 )
herzustellen.
Nun hat sich längst herausgestellt, dass dieses Ideal für
sozialwissenschaftliche Fragestellungen nicht angemessen ist. Die "soziale
Nullsituation" ist niemals konkret herstellbar gewesen, auch wenn
sie als leitende Utopie die psychoanalytische Praxis zu deren Schaden
beeinflußt hat. Die strikte Handhabung der Rahmenbedingungen ist
darauf zurückzuführen, daß sie von Analytikern überwiegend
als Spielregeln aufgefaßt werden und nicht als Mittel einer günstigen
Behandlungsstrategie. Die Frage, wie zuverlässig selbst solche
scheinbar eindeutigen Regelungen zum Ziel führen, wurde von Ludwig
Wittgenstein in aphoristischer Weise verfolgt:
<<Eine Regel steht da, wie ein Wegweiser. - Läßt er keinen Zweifel offen über den Weg, den ich zu gehen habe? Zeigt er, in welche Richtung ich gehen soll, wenn ich an ihm vorbei bin; ob der Straße nach, oder dem Feldweg, oder querfeldein? Aber wo steht, in welchem Sinne ich ihm zu folgen habe; ob in der Richtung der Hand, oder (z. B.) in der entgegengesetzten? - Also kann ich sagen, der Wegweiser läßt doch keinen Zweifel offen. Oder vielmehr: er läßt manchmal einen Zweifel offen, manchmal nicht. Und dies ist nun kein philosophischer Satz mehr, sondern ein Erfahrungssatz.>> (Wittgenstein 1960, S. 332 f. )
Regeln konstituieren eine Bedeutungsidentität, weil sie dafür
Sorge tragen, daß in der Vielfalt der Erscheinungen das Regelgeleitete
als Konstante aufgesucht werden kann: sie stellen die "Einheit
in der Mannigfaltigkeit ihrer exemplarischen Verkörperungen, ihrer
verschiedenen Realisierungen oder Erfüllungen" her (Habermas
1981, Bd. 2, S. 32 ). Diese Überlegungen sind für das Verständnis
der regelkonstituierten psychoanalytischen Situation von großer
Wichtigkeit; sie unterstreichen, daß die Bedeutung des Verhaltens
von Analytiker und Patient an die Existenz gemeinsamer Regeln gebunden
ist. Die Kleinlichkeit mancher Regelungen resultiert aus dem Bestreben,
Bedeutungsidentität zu schaffen, auch über die Grenzen der
jeweiligen Behandlungssituation hinaus. Gerade in dem von so vielen
Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten geprägten Feld der
Psychoanalyse haben Regeln die Funktion bekommen, den Zusammenhalt der
Gruppe zu stabilisieren. Die Gemeinsamkeit der Regeln dient dabei als
professionelles Kennzeichen. Dies erklärt, daß z. B. die
Benutzung der Couch und die intensive Stundenfrequenz zu einem wesentlichen
Kriterium dafür geworden sind, ob eine Behandlung als Analyse tituliert
werden darf oder nicht (Kächele 1994 ).
Der Sinn von Regeln besteht in der Intersubjektivität ihrer Geltung.
Die Schaffung von Intersubjektivität ist zugleich eine weitere
wichtige Funktion der Regeln, gerade im Bereich der Psychoanalyse. Ein
einheitlicher Rahmen garantiert die Vergleichbarkeit von Befunden usw.,
ermöglicht also scheinbar eine Standardisierung des psychoanalytischen
Verfahrens. So vielfältig Patienten beispielsweise auf die Couch
und das Liegen reagieren, besitzt doch der Analytiker ein gewisses Erfahrungsspektrum
bezüglich dieser Reaktionen und kann deshalb diagnostische und
therapeutische Rückschlüsse ziehen. Die Standardisierung des
äußeren Rahmens vermittelt allerdings häufig lediglich
einen Anschein von Gleichheit, da die Regeln in ihren Auswirkungen im
hohen Maße von zusätzlichen Bedingungen abhängig sind.
Standardisierung muß dort ihre Grenzen haben, wo der therapeutische
Prozeß behindert wird. Im Sinne Wittgensteins geht es hier um
Erfahrungssätze, die den Vergleich zwischen Regel, Weg und Ziel
zum Gegenstand haben. Tatsächlich modifizieren wir die Regeln,
wenn diese in die Irre führen, z. B. wenn das Liegen auf der Couch
eine hemmende Wirkung auf den Patienten hat .
Die Vielfältigkeit der Randbedingungen ist auch verantwortlich
dafür, daß die psychoanalytischen Behandlungsregeln kein
geschlossenes und in sich strukturiertes System bilden, sondern eher
eine Summe von Anweisungen auf verschiedenen Gebieten und von unterschiedlich
imperativem Gehalt sind.
Wieviele dieser zahlreichen Richtlinien wirkliche Spielregeln des psychoanalytischen
Sprachspiels sind und den konstitutiven Kern darstellen, ist schwer
auszumachen. Denn im Unterschied zum Schachspiel gibt es keine Regeln,
die nichts anderes bewirken würden, als daß zwei Menschen
sich zu einem Spiel zusammenfinden. Spielregeln der Psychoanalyse sind
immer zugleich auch Strategieregeln, die in jeder einzelnen Beziehung
ausgehandelt und kontinuierlich bestätigt werden müssen. Dies
unterscheidet sie vom Regelsystem des Schach, bei dem Spielregel und
Strategieregel klar getrennt sind.
Behandlungsregeln sind grundsätzlich zielorientiert, sie lassen
sich als Einzelschritte der psychoanalytischen Methodik begreifen und
dadurch mit anderen wissenschaftlichen Methoden vergleichen. Diese Zielorientierung
verbietet aber gerade jene Kanonisierung von Regeln, wie sie im Schachspiel
selbstverständlich ist. Freud war sich dieser Problematik bewußt,
und bei ihm hatte daher die Zweckmäßigkeit stets Vorrang.
Die kritische Auseinandersetzung mit der Zweckmäßigkeit von
Regeln scheint uns innerhalb der Psychoanalyse noch eher schwach entwickelt.
Regeln werden allzu häufig nicht mit ihrer Nützlichkeit, sondern
mit ihrer Verankerung in der psychoanalytischen Theorie begründet.
Nun ist diese theoretische Verankerung eine schwierige Sache. Für
die Psychoanalyse gilt, daß ihre Theorien ganz überwiegend
nach den Entstehungsbedingungen der Störung fragen, die technischen
Regeln aber an den notwendigen und hinreichenden Änderungsbedingungen
für den therapeutischen Prozess orientiert sind: Die Technik ist
in der Psychoanalyse nicht einfach eine Anwendung der Theorie.
Das Verhältnis von Spielregelfunktion und strategischer Funktion
jeder einzelnen Behandlungsregel befindet sich in ständigem Fluß.
Sicherheitsbedürfnisse und Identitätsprobleme auf seiten des
Analytikers fördern die Verabsolutierung von Regeln. Aufkommende
Schwierigkeiten im therapeutischen Prozeß erzwingen häufig
eine Überprüfung der Zweckmäßigkeit und damit eine
Infragestellung der Behandlungsempfehlungen.
Patienten tragen das ihre zu dieser Fluktuation bei: Es kann einem aufmerksamen
Patienten nicht entgehen, daß ein Analytiker in bestimmter Weise
regelhaft vorgeht, selbst wenn dem Patienten dies nicht mitgeteilt wird.
Fragen nach der Berechtigung eines solchen Vorgehens werden häufig
von den Patienten selbst aufgeworfen. Es ist deshalb nur eine Frage
der Zeit, wann in einer Analyse auch die Rahmenbedingungen zum Gegenstand
kritischer Fragen gemacht werden. Sie verlieren dann temporär ihren
Status als Rahmen und werden heftig umkämpft, bis entweder die
unbewußten Determinanten der Infragestellung verstanden und aufgelöst
oder die Rahmenbedingungen entsprechend modifiziert worden sind. Behandlungsregeln
laden gerade dazu ein, zum Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen
Patient und Analytiker zu werden; dies ist eine Erfahrung, die nicht
nur nicht vermieden werden kann, sondern vielleicht auch gar nicht vermieden
werden sollte.
In umgekehrter Weise machen sich Patienten die Regeln ihrer Analytiker
zu eigen. Cremerius (1977 ) hat an Patienten mit Über-Ich-Störungen
deren Tendenz zur Verabsolutierung von Regeln überzeugend gezeigt.
Es erübrigt sich zu sagen, daß die Effektivität der
Behandlung durch eine Verabsolutierung von Regeln ebenso stark gefährdet
wird wie durch das schrankenlose Infragestellen jeder strukturierenden
Vereinbarung. Therapeutisch ist es unerläßlich, Regeln in
Abhängigkeit von der jeweiligen Situation und den Störungen
des Patienten zu variieren. In Umkehr eines bekannten Sprichwortes möchten
wir formulieren, daß in der Psychoanalyse Ausnahmen die Regel
sind. Ob und wie die vom Analytiker eingeführten Regelungen begründet
werden, ist entscheidend durch die Art der therapeutischen Beziehung
bestimmt. Ich plädiere dafür, daß Regeln im Hinblick
auf ihre therapeutische Zweckmäßigkeit sorgfältig erläutert
werden, und daß dabei die Vorteile für die Arbeitsfähigkeit
des Analytikers sowie die Nachteile für das aktuelle Wohlbefinden
des Patienten nicht unterschlagen werden. Der analytische Prozeß
entwickelt sich dann im Wechselspiel zwischen Infragestellung und verstärkter
Etablierung der die Behandlung begleitenden Regelungen. Günstigenfalls
entwickeln Analytiker und Patient in diesem Wechselspiel gemeinsam das
für die Behandlung optimale Regelverständnis.
Behandlungsempfehlungen widerspiegeln im Bereich der Psychoanalyse das
ganze Spektrum von theoretischen Grundannahmen, Zielvorstellungen und
klinisch gewonnenen Erfahrungen.
Ganzes Dokument
Tel. +39 3336347740 imagoricerche@gmail.com
